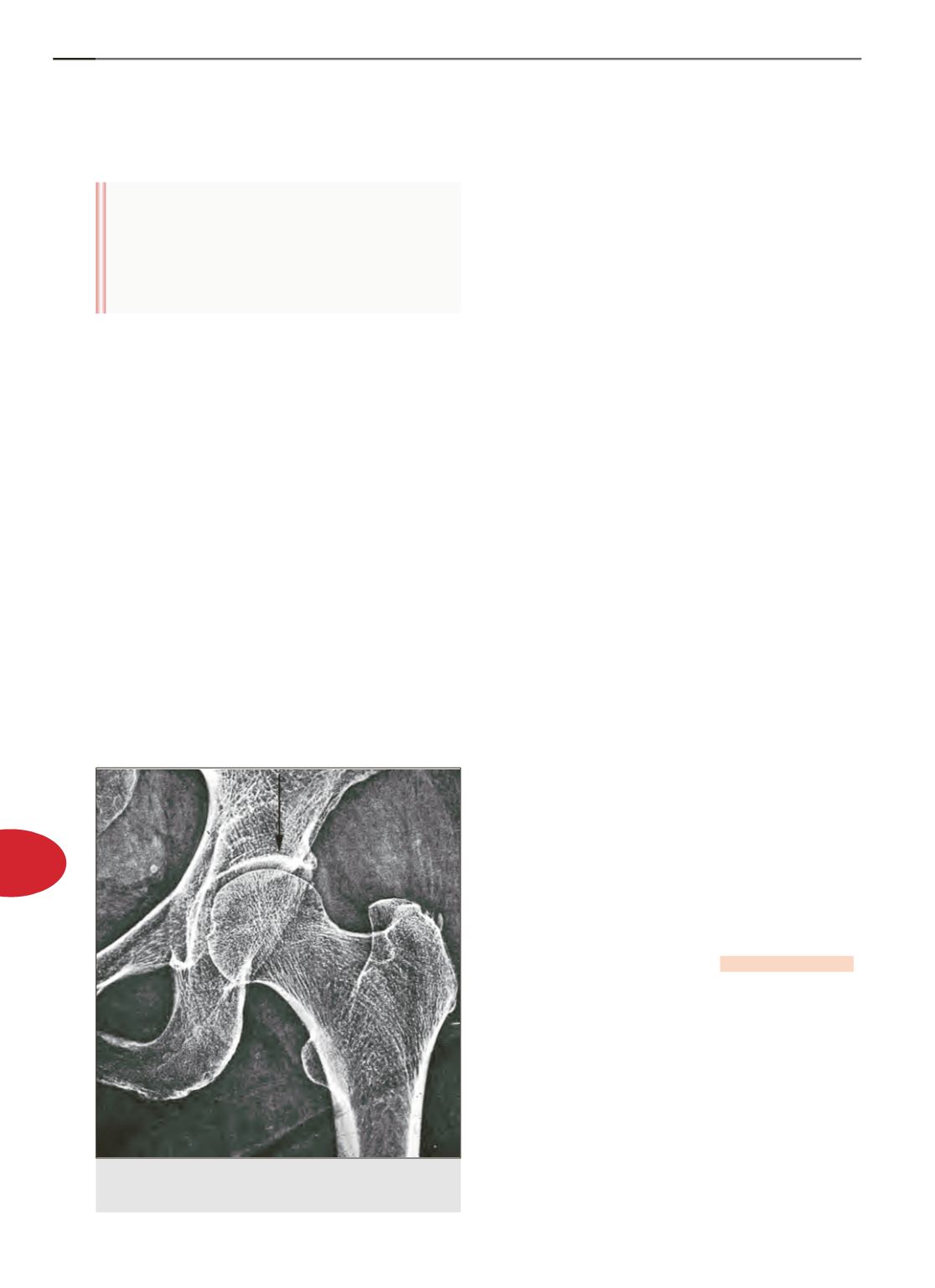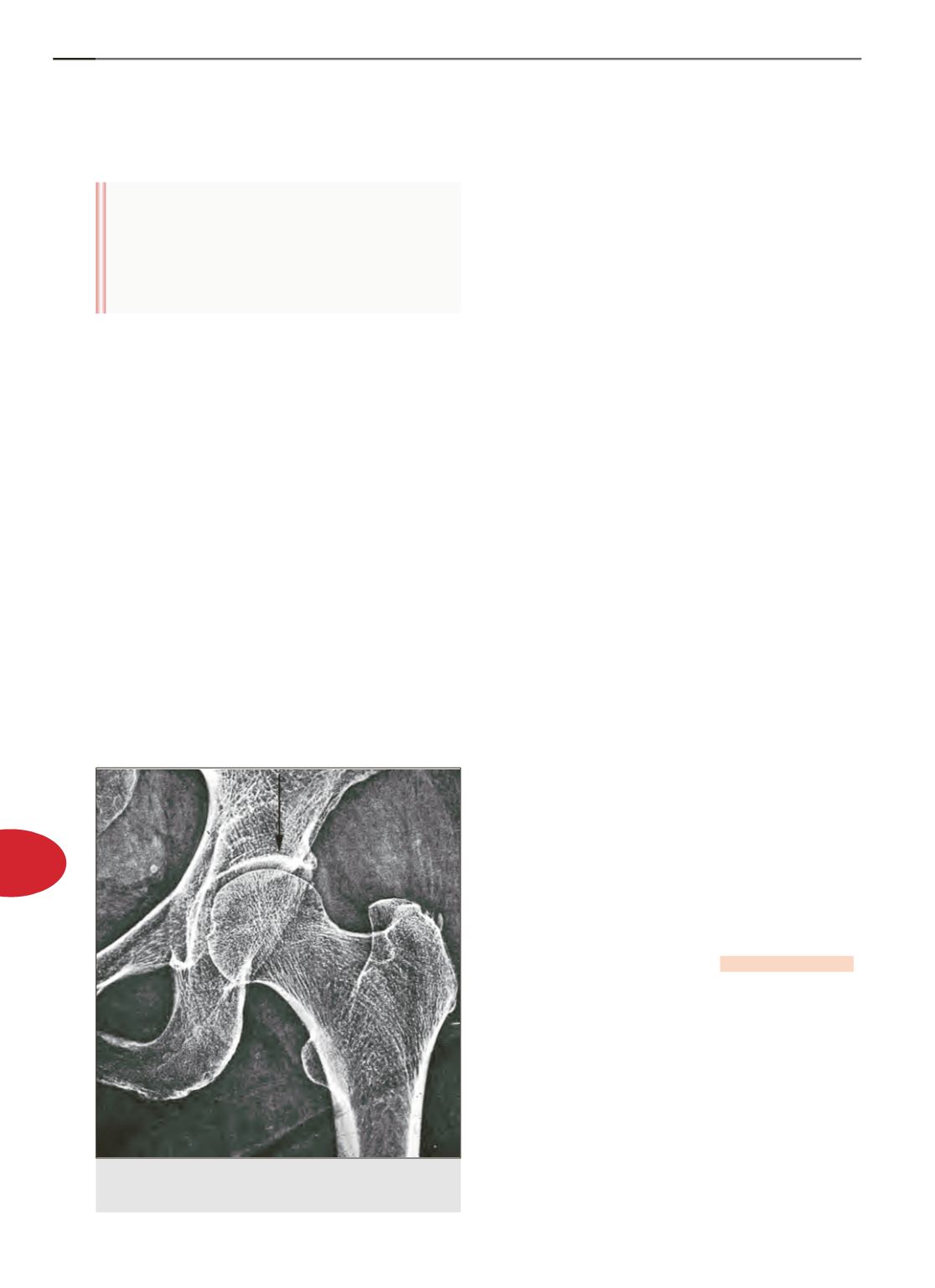
198
Untere Extremität
(Pars libera membri inferioris)
12
12.1 Hüftgelenk
(Art. coxae)
12.1.1 Beteiligte Strukturen und Knochen des
Hüftgelenks
Die am Hüftgelenk beteiligten Knochen sind
•
die Hüftgelenkspfanne
(Acetabulum)
des Hüft-
beins
(Os coxae),
die sich aus dem Darmbein
(Os
ilium),
dem Sitzbein
(Os ischii)
und dem Scham-
bein
(Os pubis)
zusammensetzt und
•
das Schenkelbein
(Femur).
Hüftgelenkspfanne
(Acetabulum)
Die artikulierenden Flächen des beim Stehen, Gehen,
Laufen und Springen mechanisch stark belasteten
Hüftgelenks,
das ein
modifiziertes Kugelgelenk
mit
drei Freiheitsgraden darstellt, werden von dem zu zwei
Drittel überknorpelten, nach allen Richtungen einen
gleich großen Krümmungshalbmesser aufweisenden,
im Durchmesser 4–5 cm großen Schenkel
kopf
(Caput
femoris)
und der mondsichelförmigen, 2–3 cm breiten
Gelenkpartie
(Facies lunata) der
konkaven Gelenk
pfanne
(Acetabulum)
gebildet (Abb. 12.1). Sie kann mit einem
Hohlkugelhalbschnitt, der der Quere nach 170–175°,
der Pfeilrichtung nach sogar 180° umfasst, verglichen
werden. Der tiefe Boden der Pfanne
(Fossa acetabuli)
wird
durch ein Polster aus lockerem Binde- und Fettgewebe
ausgefüllt, das dünne Blutgefäße enthält. Die
Funktion
dieses Pfannengrundgewebes besteht in einer Pufferung
von Erschütterungen, die vom Schenkelkopf auf die
Hüftgelenkspfanne übertragen werden.
Der knöcherne Pfannenrand wird von einem dreisei-
tig prismatischen, bis zu 1 cm breiten faserknorpeli-
gen Streifen, der
Pfannenlippe
(Labrum acetabulare)
,
umsäumt, wobei der Einschnitt im unteren Pfannen-
rand
(Incisura acetabuli)
in Form eines 1 cm breiten,
überknorpelten Querbandes
(Lig. transversum acetabuli)
eine Überbrückung erfährt. Durch diese Pfannenlippe
wird der konkave Gelenkkörper derartig vertieft und
vergrößert, dass er nunmehr zu drei Viertel den Kopf
des Schenkelbeins – wie die Nussschale ihren Kern – eng
und weitgehend umschließen und somit die Bewegun-
gen des Beins im Hüftgelenk sichern und stabilisieren
kann; man bezeichnet deshalb dieses Gelenk oft auch als
„Nussgelenk
“
(Enarthrose)
. Der Grad der knöchernen
Überdachung des Schenkelbeinkopfs hängt vom Aus-
maß des Beckenneigungswinkels (s. o.) ab, der in einem
funktionellen Zusammenhang mit derWirbelsäule steht
und sich im Verlauf des Lebens ändert, und zwar von
60° beim Kleinkind über 47° beim Erwachsenen bis zu
41° beim Gealterten. Die Hüftgelenkspfanne weist eine
subchondrale Sklerosezone an der höchsten Erhebung
auf, die ein Teil der überknorpelten
Facies lunata
ist und
über die (Abb. 12.1, Pfeil) – auch als „Tragfläche“ be-
zeichnet – die Last des Körpers (oft mit Zusatzlasten)
auf die untere Extremität übertragen wird.
Der faserknorpeligen Umrandung der Hüftgelenkspfan-
ne wird auch die Aufgabe zuteil, Unebenheiten, die durch
die in der Mitte der Pfanne in Form eines Y zusammen-
tretenden drei Teile des Hüftbeins am knöchernen Rande
auftreten können, auszugleichen und letzten Endes auf
Grund der in der Pfannenlippe vorhandenen Elastizität
demKopf eine wenn auch nur geringfügige Nachgiebig-
keit zu gewähren, ohne dass darunter der feste und si-
chere Kontakt der beiden artikulierenden Flächen leidet.
Sie werden von einer trichterförmig gestalteten, relativ
weiten
Gelenkkapsel
– der dicksten und kräftigsten des
gesamten Bewegungsapparats – umhüllt, die vom Rand
der Hüftgelenkspfanne sowie vomQuerband entspringt,
den größtenTeil des Schenkelhalses umschließt und vorn
an der Zwischenrollhügellinie des Schenkelbeins
(Linea
intertrochanterica)
ansetzt.
Schenkelbein
(Femur)
Dieser mit 40–50 cm
größte
und
längste Knochen
des
menschlichen Skeletts (Abb. 12.2, Tafeln 12.1–12.4 )
besteht wie jeder andere Röhrenknochen aus zwei End-
stücken
(Epiphysen)
und einemMittelstück, dem Schaft
(auch
Diaphyse
genannt)
.
Das proximale und das distale
Ende weisen wie beim Oberarmbein je einen konvexen
Gelenkkörper für das Hüft- bzw. Kniegelenk auf.
Oberes Drittel
Das Schenkel
bein
(Femur)
lässt im Bereich seines obe-
ren Drittels den fast kugelig gestalteten Schenkel
kopf
(Caput femoris)
erkennen, der etwas unterhalb der Mitte
der hyalin-knorpeligen Gelenkfläche eine kleine, runde
Vertiefung
(Fovea
capitis)
für den Ansatz des aus der
Abb. 12.1
Trabekelverlauf im proximalen Femurende und Skle-
rosezone („Tragfläche“) in der Hüftgelenkspfanne.