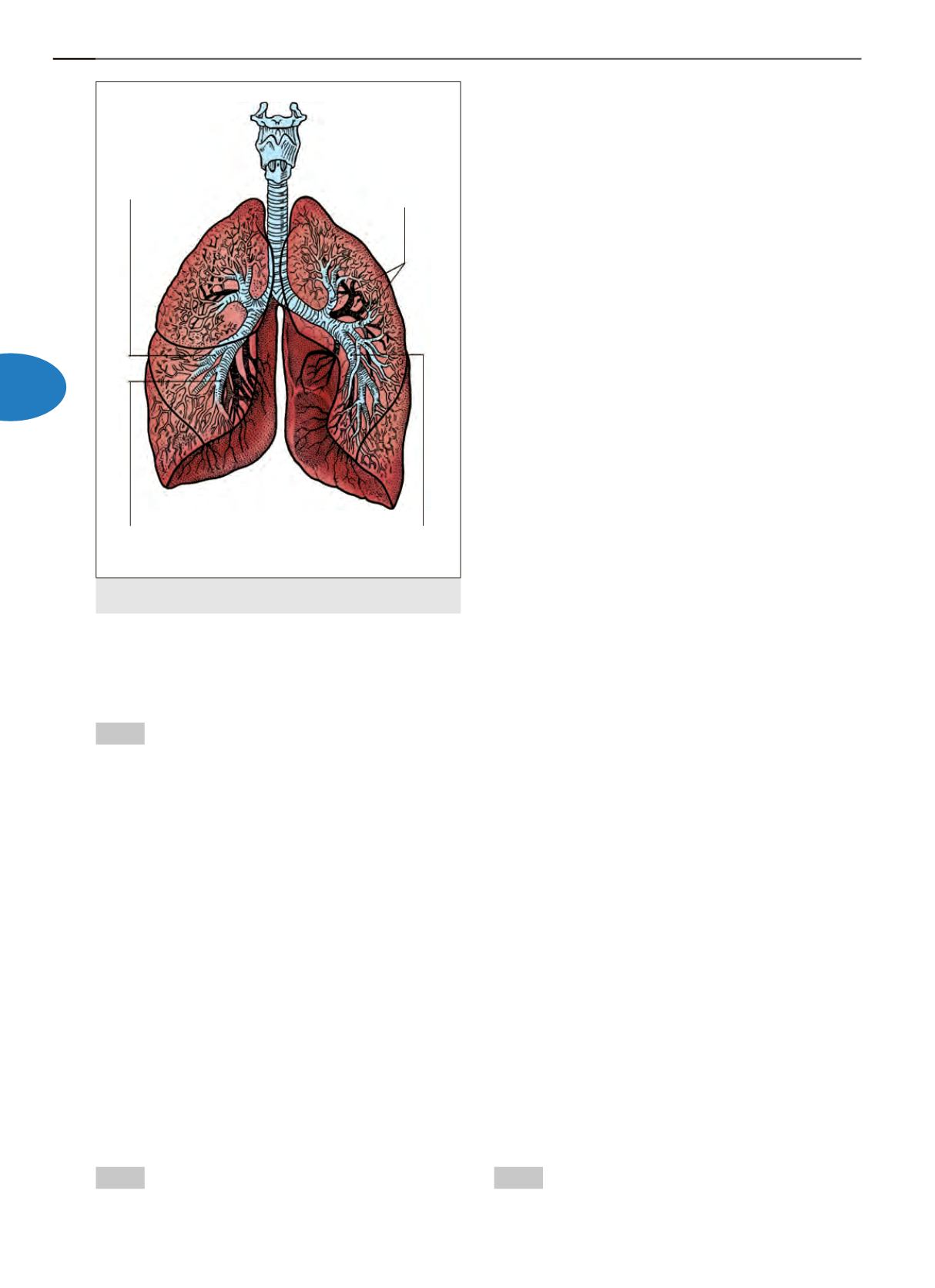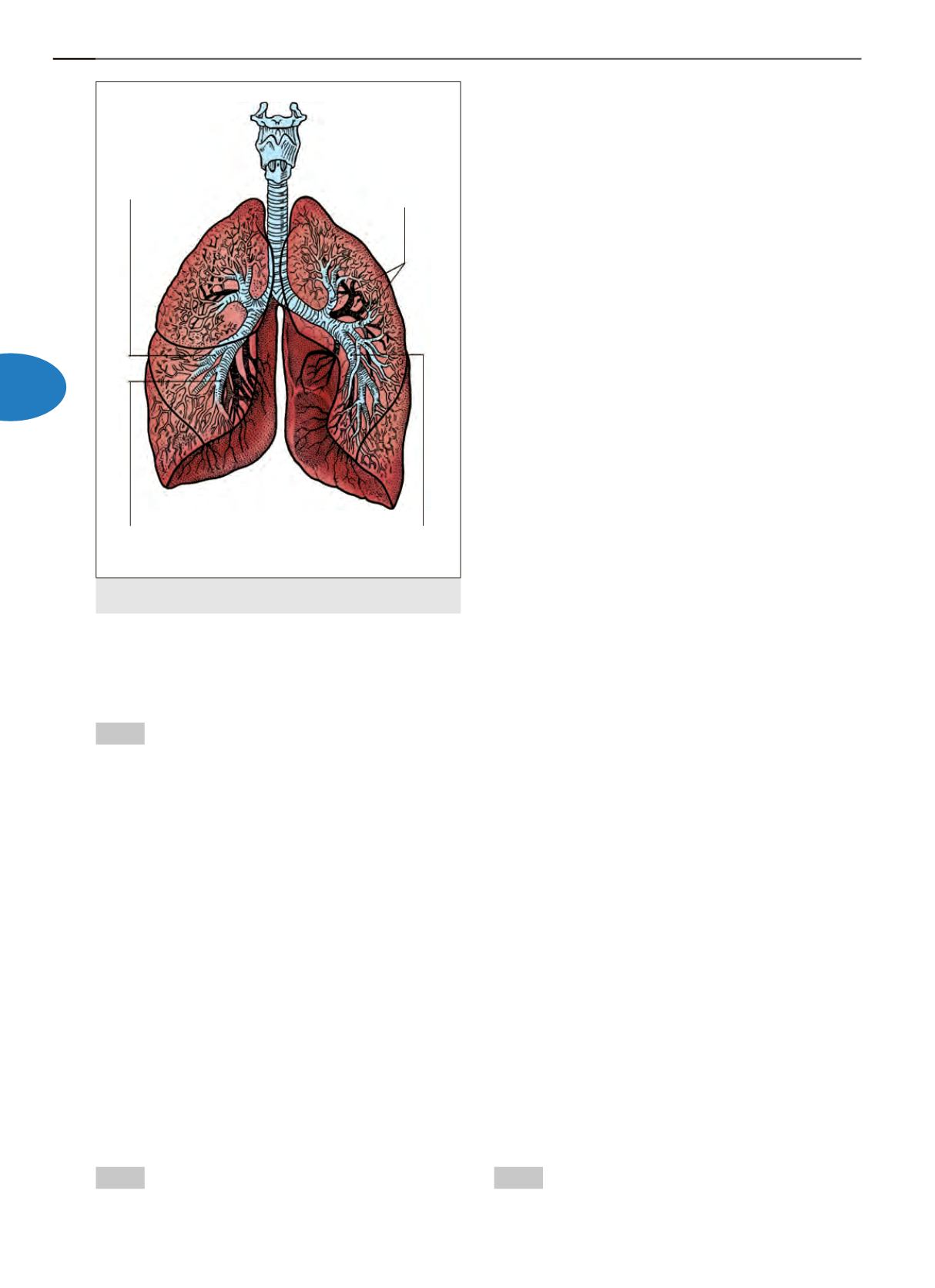
382
Das Atemsystem
(Respirationstrakt)
19
zirkulär angeordnetes
Muskelgewebe,
so dass nunmehr
der Querschnitt der kleineren Äste des Atmungssystems,
die insgesamt den Hauptanteil beim Aufbau des Lun-
gengewebes ausmachen, aktiv reguliert werden kann.
K
linik
Dies besitzt vor allem für die Klinik eine recht erhebliche
Bedeutung, als durch einen Krampfzustand der glatten Muskulatur –
hervorgerufen durch eine Übererregung der glatten Muskulatur durch
Histamin – ein
Bronchialasthmaanfall
(mit sehr erschwerter Ausat-
mung) ausgelöst werden kann. Dazu tragen oft Allergien (gegen Pollen
von Blumen, Gräsern, Hausstaub), Infekte der Atemwege und Reizstoffe
bei, die durch eine Anschwellung der Schleimhaut zur Verengung der
Atemwege beitragen können.
Das bereits in der Nasenschleimhaut kennengelernte
mehrreihige
Flimmerepithel
mit Becher- und Bürsten-
saumzellen, das auf seiner Oberfläche eine dünnflüssige
Sekretschicht aufweist, wird auch im Kehlkopf, in der
Luftröhre und in deren großen Aufzweigungen unter
fortschreitender Abflachung des Epithels angetroffen.
Der Schlag der zahlreichen feinen Flimmerhärchen (oder
Geißeln) ist rachenwärts gerichtet, um eingedrungene
Fremdkörper umgehend nach außen befördern zu kön-
nen. Die Stimmfalten
(Plicae vocales)
jedoch besitzen auf
ihrem freien Rand
Plattenepithel
.
Deshalb kann der
Schleim über diese Schwelle nur durch Räuspern oder
Husten weiterbefördert werden.
K
linik
Durch die ununterbrochene Einwirkung scharfen Staubs,
wie er beispielsweise in Diamantschleifereien, bei Bohrungen imStein-
bruch usw. auftritt, wird das Flimmerepithel im Bereich der Atemwege
nach und nach geschädigt und damit das Deckgewebe seiner Schutz-
funktion beraubt, so dass nun Schmutzteilchen und Bakterien unge-
hindert in das Innere der Lungen gelangen können. Manche im Beruf
zugezogene Lungenerkrankung wie beispielsweise die „Staublunge“
(Silikose)
hat auf diese Art ihren Anfang genommen.
19.3 Innere Atmung
Dem bisher beschriebenen,
luftleitenden Abschnitt
des
Atmungssystems („äußere“ Atmung mit Respirations-
epithel) folgt nunmehr der Bereich des
Gasaustauschs
in den Lungen („innere“ Atmung mit
Alveolarepithel
).
Die sack- bzw. traubenförmigen, blinden Endigungen
des Atemapparats, die bei Einatmung 0,3–0,5 mm, bei
Ausatmung 0,1–0,2 mm großen
Lungenbläschen
oder
Alveolen
(Abb. 19.7), beanspruchen unser besonderes
Interesse, da sie in ihrer Gesamtheit – es werden ins-
gesamt etwa 500–600 Millionen Alveolen angegeben
– die
funktionelle Oberfläche für den Gasaustausch
des Blutes
(Aufnahme von O
2
und Abgabe von CO
2
)
darstellen und beim Erwachsenen rund 100–120 m
2
ausmachen, eine Fläche, die 60-mal so groß wie die Kör-
peroberfläche ist und die täglich mit 7000–8000 Liter
Blut in engstem Kontakt steht.
Die sehr dünne,1 µm messende
Alveolarwand
besteht
neben argyrophilen und lockeren Bindegewebsfasern
aus einem korbartigen elastischen Fasernetz, sodass jede
Alveole mit der Atmung vergrößert bzw. verkleinert wer-
den kann. Das Fasernetz wird von einem engmaschigen
Kapillarnetz umgarnt, so dass auf Grund des engen Kon-
takts zwischen Blut und Alveolarluft (die 2,2 µm dicke
„Blut-Luft-Schranke“) und des langsamen Blutstroms ein
ungehinderter Gasaustausch
in optimalerWeise durch
Diffusion vor sich gehen kann (Abb. 19.7). Dabei sind
zwei Dinge zu beachten:
•• Während einer aeroben körperlichen Belastung muss
den Skelettmuskelfasern ständig Sauerstoff zugeführt
werden, da er nur in sehr geringem Umfang gespei-
chert werden kann.
•• DesWeiteren hängt der intrazelluläre Sauerstoffbedarf
von der aeroben Energieleistung ab; er beträgt beim
Muskel in Ruhe 40 ml/min/× kg.
Im Energiestoffwechsel spiegelt sich die Sauerstoffauf-
nahmefähigkeit wider, die abhängig ist vom Sauerstoff-
gehalt der Luft, von der Leistungsfähigkeit des Herz-
Kreislauf-Systems, dem Herz-Minuten-Volumen, dem
Blutvolumen und Hämoglobingehalt sowie von der
Anzahl der Mitochondrien in der Skelettmuskulatur.
Körperliche Leistungen unterschiedlicher Dauer und
Intensität erfordern seitens der Muskeln deshalb eine
erhöhte Sauerstoffzufuhr und lösen gleichzeitig eine ver-
tiefte Atmung aus.
S
port
Die maximale Diffusionskapazität für Sauerstoff weist eine
enge Beziehung zur körperlichen (sportlichen) Leistungsfähigkeit auf.
Abb. 19.6
Bronchialbaum der rechten und linken Lunge.
vordere Äste
des Stammbronchus
im linken Oberlappen
Stammbronchus
im linken Unterlappen
vordere Äste
des Stammbronchus
im rechten Mittellappen
Stammbronchus
im rechten Unterlappen