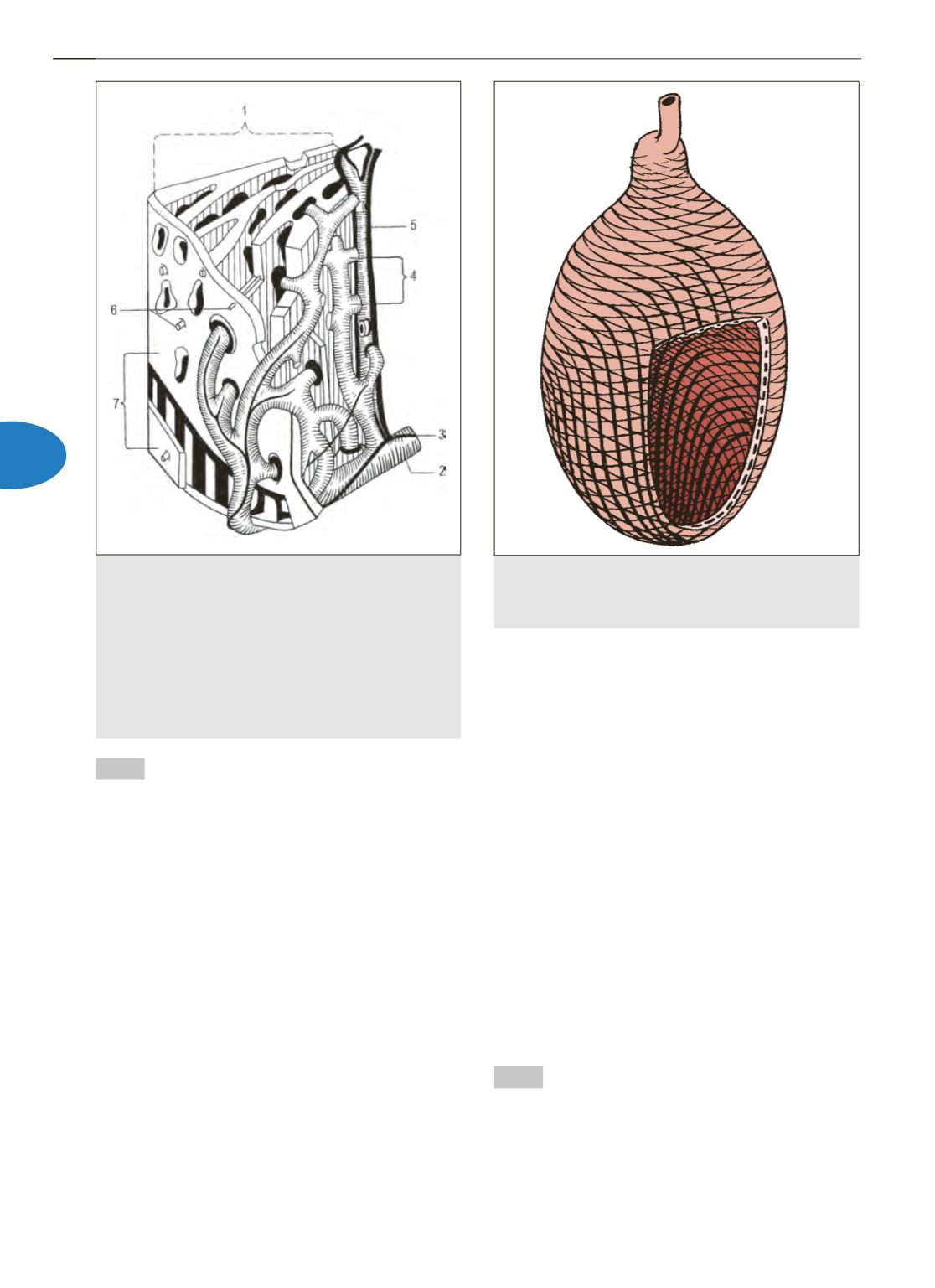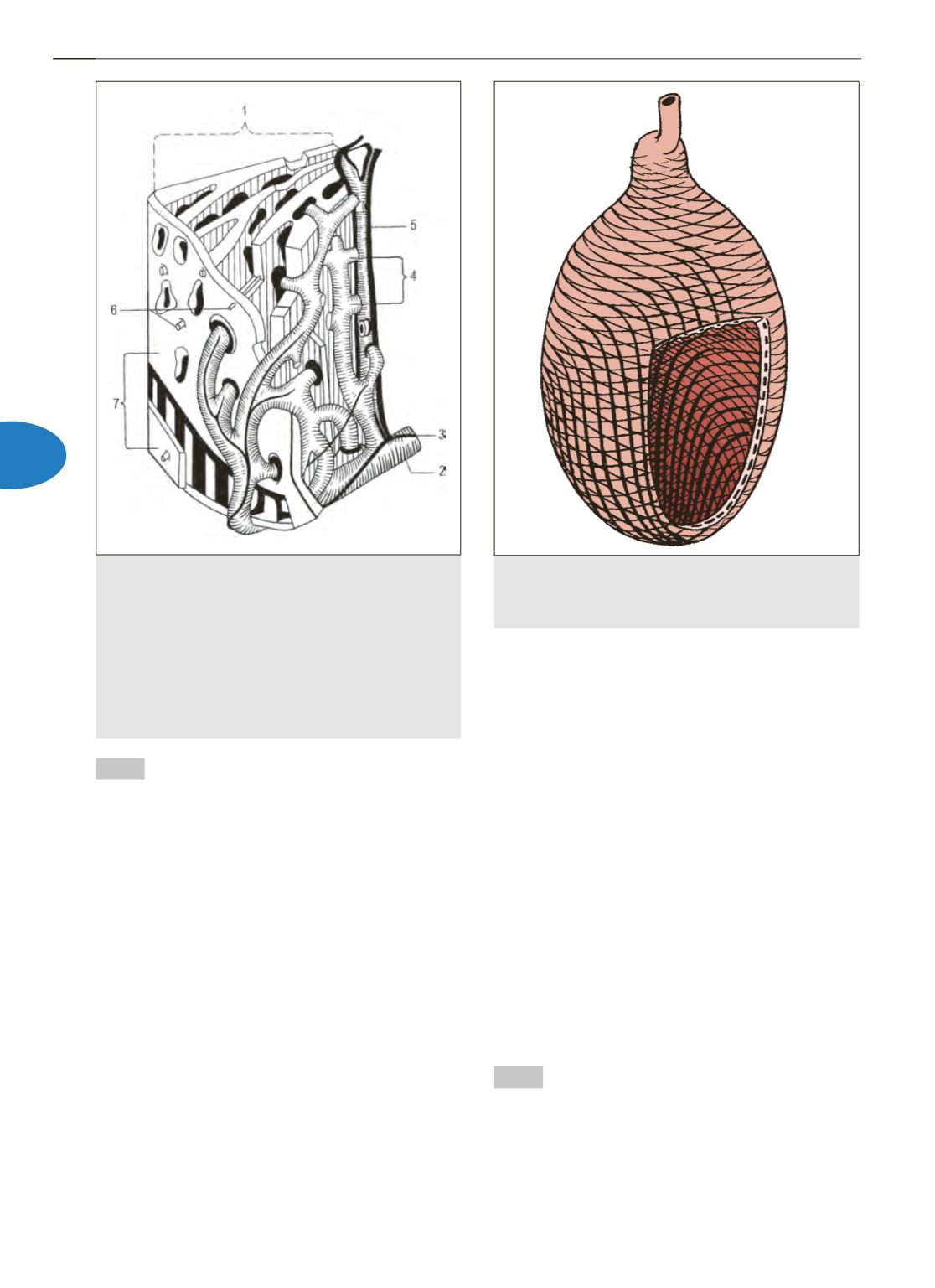
400
Das Verdauungssystem
(Gastrointestinaltrakt)
20
S
port
An die Leber werden speziell während hoher Ausdauerbela-
stungen große Anforderungen gestellt. So müssen beispielsweise bei
einem Straßenradrennen in einem Zeitraum von 4–5 Stunden etwa
4500 kal umgesetzt werden. Athleten, die sich einem mehrjährigen
Ausdauertraining unterziehen, reagieren sehr oft mit einer deutlichen
Lebervergrößerung, die nach dem Abtrainieren nicht mehr fühlbar ist,
wobei auf dem Höhepunkte der Leistungsfähigkeit eine feste Korrela-
tion zwischen Herzgröße und Lebergewicht besteht.
Die an den Flächen benachbarter Leberzellen verlau-
fenden und von ersteren gebildeten wandlosen Gallen-
röhrchen oder -kapillaren, die die von den Leberzellen
gebildete Gallenflüssigkeit sammeln, vereinigen sich an
der Oberfläche eines Leberläppchens zu den nunmehr
mit selbständiger Wand versehenen im Durchmesser
10–15 µm großen Gallengängen
(Ductuli biliferi),
die
in den Lebergang (
Ductus hepaticus,
s. o.) einmünden.
Dieser bildet, nachdem er die Leber im Bereich der
Leberpforte verlassen hat, gemeinsam mit dem Gal-
lenblasengang
(Ductus cysticus),
der im spitzen Winkel
von der Gallenblase kommend an ihn herantritt, den
gemeinsamen Gallengang
(Ductus choledochus),
der zur
Papille des Zwölffingerdarms
(Papilla duodeni major,
Vater-Papille) zieht.
Die an Cholesterin reiche und durch den Gehalt an
gallertsauren Salzen sehr bitter schmeckende alkalische
Galle
stellt auf Grund des Muzingehalts eine fadenzie-
hende, schleimige Flüssigkeit dar, die in der Gallenblase
gesammelt und eingedickt wird, um für die Verdauung
(insbesondere der Fette) in ausreichender Menge zur
Verfügung zu stehen. Die Blasengalle enthält u. a. Gal-
lensäuren, die Fette imDünndarm emulgieren (um nach
Rückresorption im Krummdarm über die Pfortader zur
Leber zurückzugelangen), Gallenfarbstoffe, Cholesterin,
Salze und Schleim.
20.6.2 Gallenblase
Die Gallenblase (
Vesica fellea; fel
= Galle) ist in ihrer
Gestalt mit einer lang gestreckten Birne zu vergleichen,
die etwa 8–10 cm lang und 3–4 cm breit ist und ein
Volumen von 40–50 cm
3
aufweist. Es werden an ihr drei
Abschnitte unterschieden: ein Hals
(Cervix),
ein Körper
(Corpus)
und ein Grund
(Fundus).
K
linik
Der Fundus überragt normalerweise etwas den vorderen
Leberrand und ist hier (insbesondere bei Gallenblasenentzündungen)
als druckschmerzhafte Vorwölbung deutlich zu tasten.
Die in einer muldenförmigen Vertiefung im Bereich der
unteren Leberfläche ruhende Gallenblase besitzt in ihrem
Inneren ein einschichtiges hoch prismatisches Epithel,
das wie das des Dickdarms Wasser resorbiert, so dass die
Abb. 20.19
Schraubenförmige Schräg- und Längsfaserung (und
deren innige Verbindung miteinander) der glatten Muskulatur im
Bereich der Gallenblasenwand.
Abb. 20.18
Schema von den radiär angeordneten Leberzell-
platten.
1 = radiär verlaufende Leberplatte
2 = Endast der Pfortaderaufzweigung
(V. interlobularis)
3 = Endast der Leberschlagaderaufzweigung
(A. interlobularis)
4 = Äste der V. interlobularis
(Vv. intralobulares)
5 = im lnnern eines Leberläppchens gelegene Vene
(V. centralis)
6 = Gallenkapillaren
7 = äußere Wand eines Leberläppchens