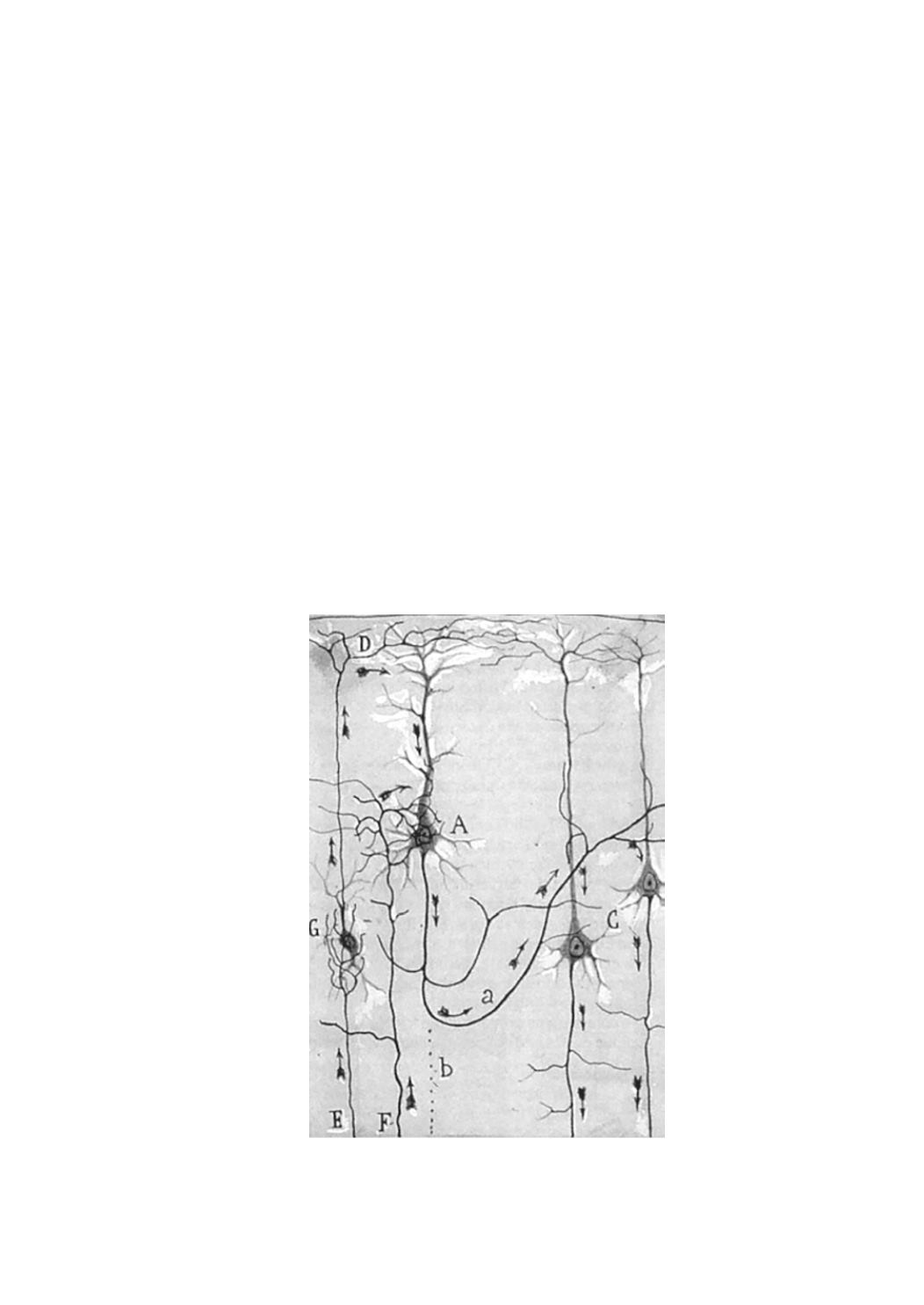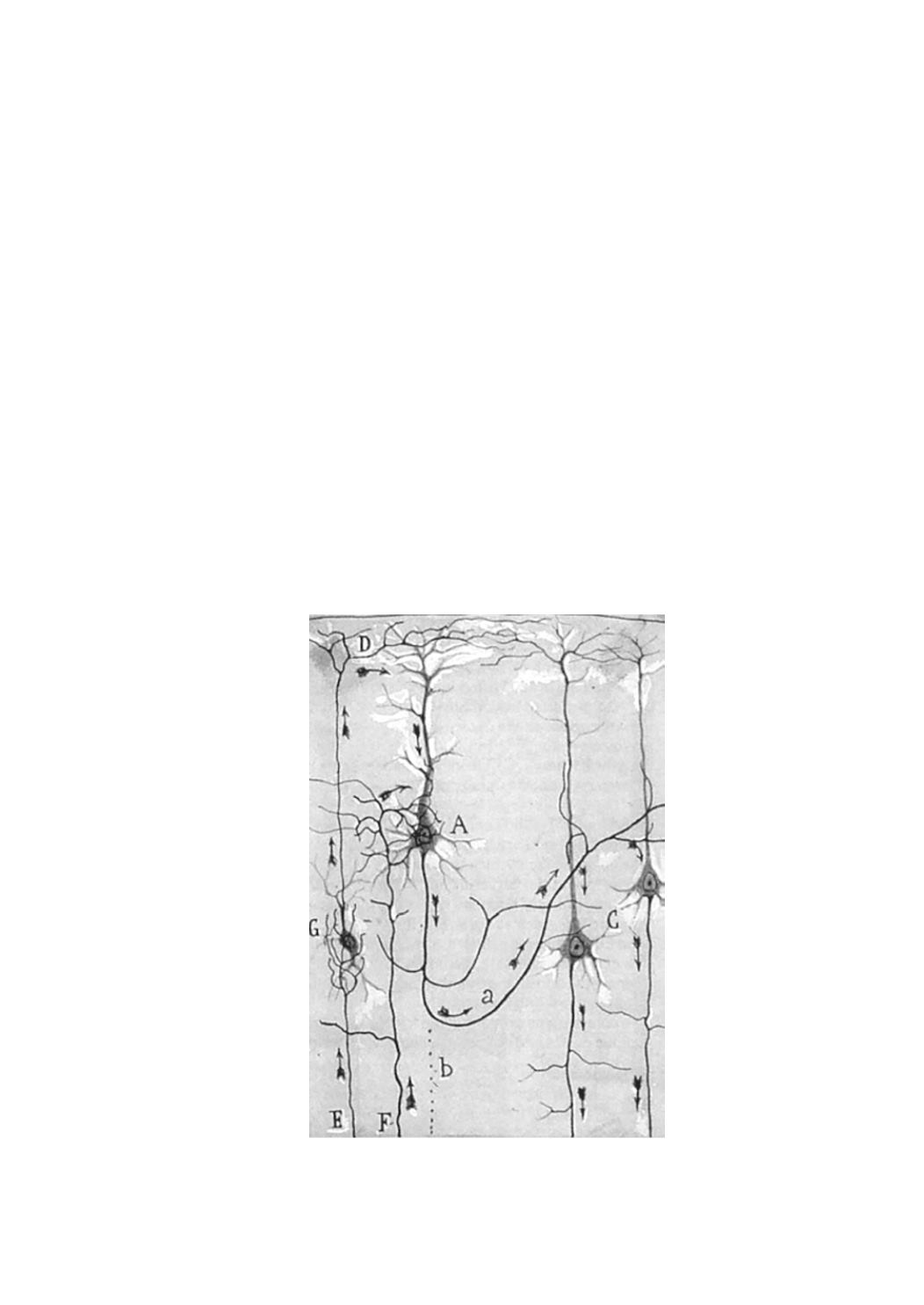
Neurorehabilitation heute
2
tet. Gemäß dieser Lesart würde man nach einer Schädigung des Gehirns für immer beeinträch-
tigt bleiben.
Es ist eigentlich unverständlich, dass sich diese Auffassung so hartnäckig gehalten hat und
teilweise noch hält, weil bereits um 1900 die ersten Meinungsabweichler hirngeschädigte Patien-
ten mit auffälliger Wiederherstellung der Funktion vorgestellt haben. In den letzten Jahren erle-
ben wir dann endlich einen Paradigmenwechsel: Heute betrachten wir das Gehirn als
plastisch
.
Zwei Pioniere zum Thema Plastizität des Gehirns möchten wir hier erwähnen:
Während seiner ausführlichen anatomischen und histologischen Studien des Nervensystems
verwandte
Santiago Ramon y Cajal
(1852−1932) eine im Jahre 1873 von
Golgi
entwickelte
Technik zur Schwarzfärbung von Neuronen. Seine mikroskopischen Studien von Hirnläsionen
brachten ihn entgegen der landläufigen Meinung zu der Auffassung, dass auch im ZNS regene-
rative Prozesse stattfinden können. Bereits 1913 konnte er im menschlichen Kortex Plastizität
nachweisen. Abbildung 1.1 zeigt zahlreiche retrograde junge Axonaussprossungen nach einem
Defekt im Bereich der kortikospinalen Bahnen. Er bezeichnete diesen Prozess mit dem Begriff
„neuronale Plastizität“. Dennoch hat Cajal es nicht gewagt, das statische Modell ganz zu ver-
lassen, da er immer von der Notwendigkeit einer gewissen Strukturstabilität überzeugt war (De
Felipe, 2002; Stahnisch und Nitsch, 2002).
Aufgrund einer ganz anderen Vorgehensweise kam der Philosoph und Psychologe
William
James
(1842–1910) zum gleichen Schluss. Sein monumentales Werk „The Principles of Psycho-
logy” (besser bekannt unter der Bezeichnung „The Principles“) beginnt mit der Abbildung eines
Abb. 1.1 Plastizität der Hirnrinde
Die Zeichnung zeigt die histologischen Folgen einer Läsion efferenter Axone der kortikalen Pyramidenzellen
(A). Das geschädigte Axon degeneriert distal (b), vom proximalen Ende sprossen mehrere Axonen aus (u. a.
bei a) und stellen Kontakt her mit Nachbarneuronen (C). Der Informationsfluss innerhalb der Hirnrinde wird
also umgeleitet (nach De Felipe, 2002).