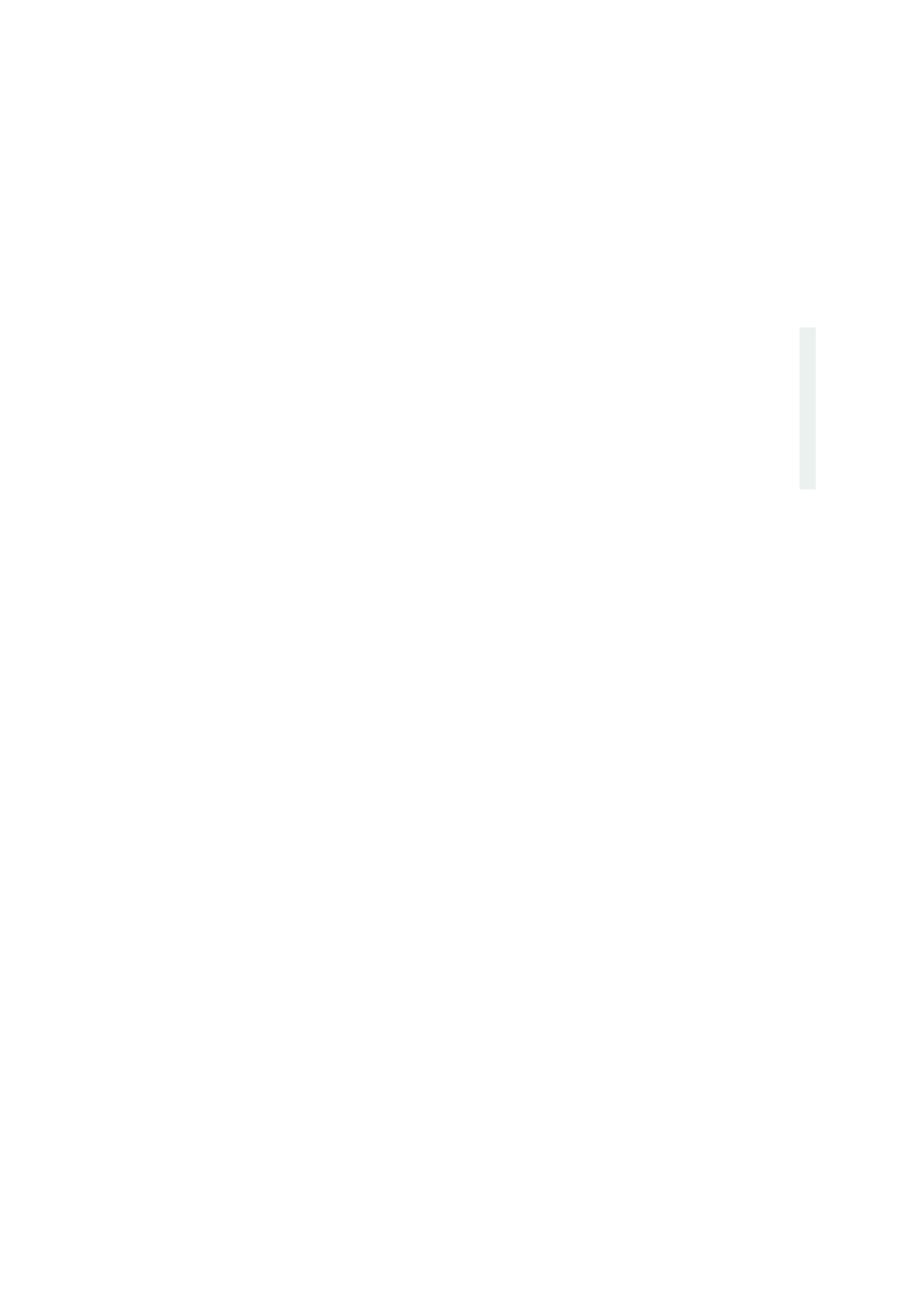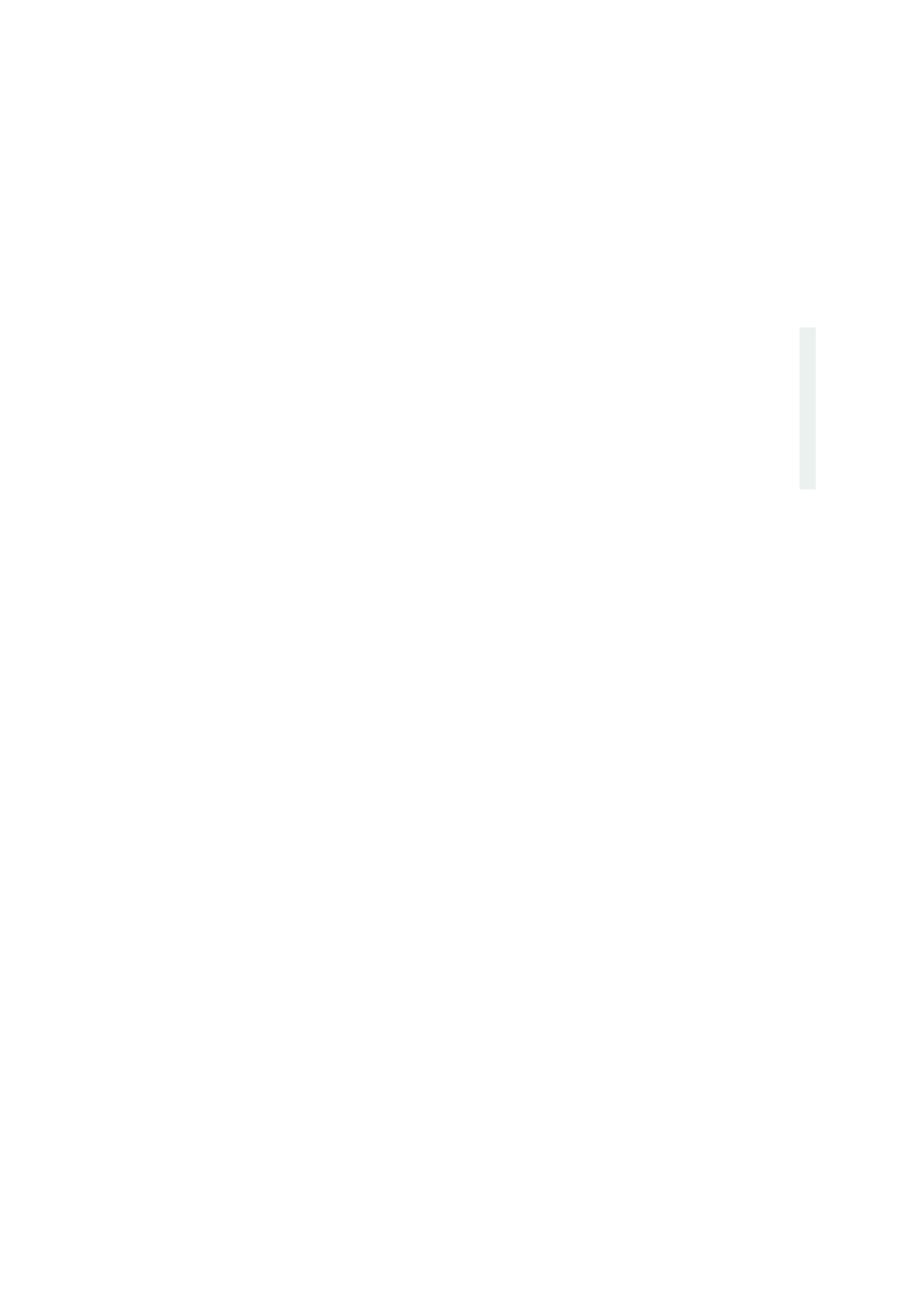
7.1 Verhalten
193
7.1 Verhalten
Mit „komplexen Verhaltensweisen“ meinen wir hier nicht das Verhalten selbst, sondern seine
Ursachen und Entstehungsweise. So ist z. B. Fluchen eine recht einfache Verhaltensweise. Nicht
einfach ist jedoch die Frage, warum Fluchen bei bestimmten Schädigungen des Gehirns auftritt.
Wie die Motorik und die Wahrnehmung, so haben auch Emotionen und Verhalten irgendwo
im Gehirn eine neurale Basis. Darum ist verständlich, dass nach Hirnläsionen häufig auch Stö-
rungen des Verhaltens und der Persönlichkeit auftreten, die wiederum großen Einfluss auf den
Verlauf der Rehabilitation und der Reintegration haben können.
Ein intelligenter junger Mann trägt nach einem Schädel-Hirn-Trauma fast keine körperlichen
Behinderungen davon, leidet aber unter regelmäßigen Wutausbrüchen, die sein Funktionieren
in Beruf oder Schule erschweren, innerhalb seiner Familie oft Probleme verursachen und in sei-
nem sozialen Leben (mit Freunden, im Supermarkt usw.) regelmäßig zu unangenehmen Zwi-
schenfällen führen. Obwohl dieser junge Mann aufmerksam und intelligent ist und kaum kör-
perliche Behinderungen hat, ist eine Rückkehr in ein normales Leben deutlich erschwert, wenn
nicht gar unmöglich.
Verhaltensstörungen nach einer Hirnschädigung können also für das weitere Leben eines Pati-
enten von entscheidender Bedeutung sein.
Das aufgeführte Beispiel ist kein Einzelfall, solche Probleme werden recht häufig gemeldet. In
unserem Gesundheitswesen, zu dem auch die Rehabilitation gehört, liegt wie selbstverständlich
der Schwerpunkt auf der körperlichen Wiederherstellung. In der Therapie wird den Hemipare-
sen und der Wiedergewinnung der ADL-Selbstständigkeit die größte Aufmerksamkeit gewid-
met. Die kognitive Rehabilitation entwickelt sich gerade erst, Verhaltensrehabilitation ist oft
nicht möglich oder steckt noch in den Kinderschuhen.
Nach einer Hirnläsion auftretende Verhaltensstörungen werden meist als „erschwerender
Faktor“ für die Rehabilitation eingestuft. Ein „unkooperativer“ Schlaganfallpatient ist für eine
Rehabilitation „nicht geeignet“. Verhaltensstörungen gelten also als ein zusätzliches Problem, das
für andere Therapien als hinderlich angesehen wird. Die ratlosen Eltern oder der Lebenspart-
ner werden von Hü nach Hott geschickt und verstehen nicht, warum der Patient zwar Beruhi-
gungsmittel, aber keine Therapie seines Verhaltens erhält. Der Patient selbst befindet sich mit
seinem Verhaltensproblem in einem therapeutischen Niemandsland, irgendwo zwischen Reha
und Psychiatrie.
Wir möchten betonen, dass endlich einmal dieVerhaltensstörung selbst das zentrale Anliegen der The-
rapie sein sollte. Aber leider sind die Dinge noch nicht so weit.
Unsere Reha-Einrichtungen sind auf Verhaltensstörungen bisher nicht eingestellt. Der britische
Autor
Alderman
nennt dafür folgende Gründe (in Wood und McMillan, 2001):
●●
Die meisten Reha-Zentren sind ungeeignet; sie bieten zu wenig Ruhe und zu viele Ablen-
kungsmöglichkeiten.
●●
Weder Ärzte noch Psychologen oder andere Dienstleister besitzen die erforderliche Ausbildung,
Expertise und Erfahrung. Oft herrscht die simplifizierende Auffassung vor, dass der Patient sich
„absichtlich” störend verhalte, um Aufmerksamkeit oder Zuwendung zu erhalten.
●●
Es gibt ein implizites therapeutisches Vorurteil, dem zufolge hirnorganische Verhaltensstö-
rungen behandlungsresistent seien. Diese Auffassung ist willkürlich und grundsätzlich falsch.
●●
Lästige Patienten machen sich unbeliebt. Wer will sich dann Mühe mit ihnen geben? Man
geht ihnen lieber aus dem Weg.