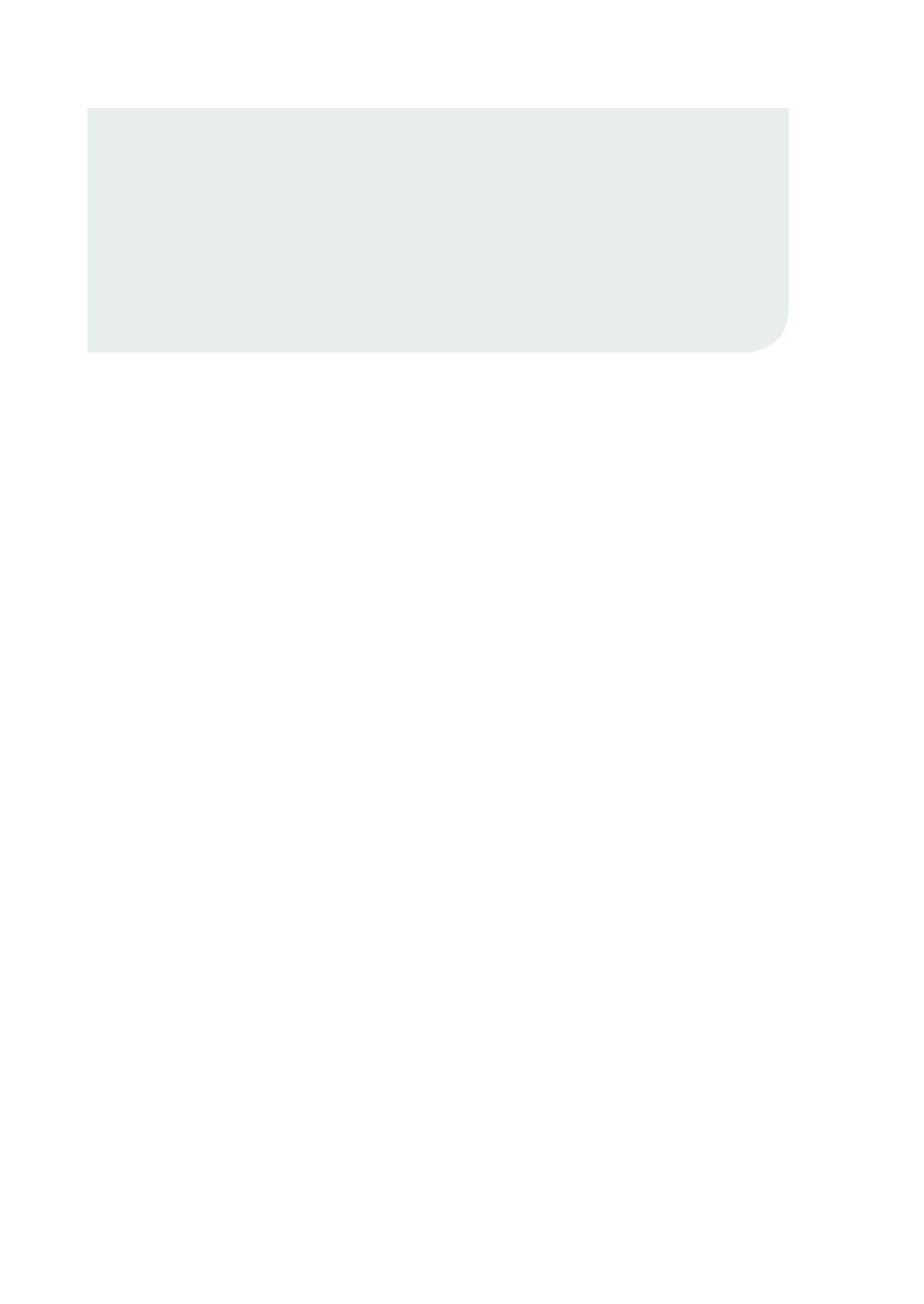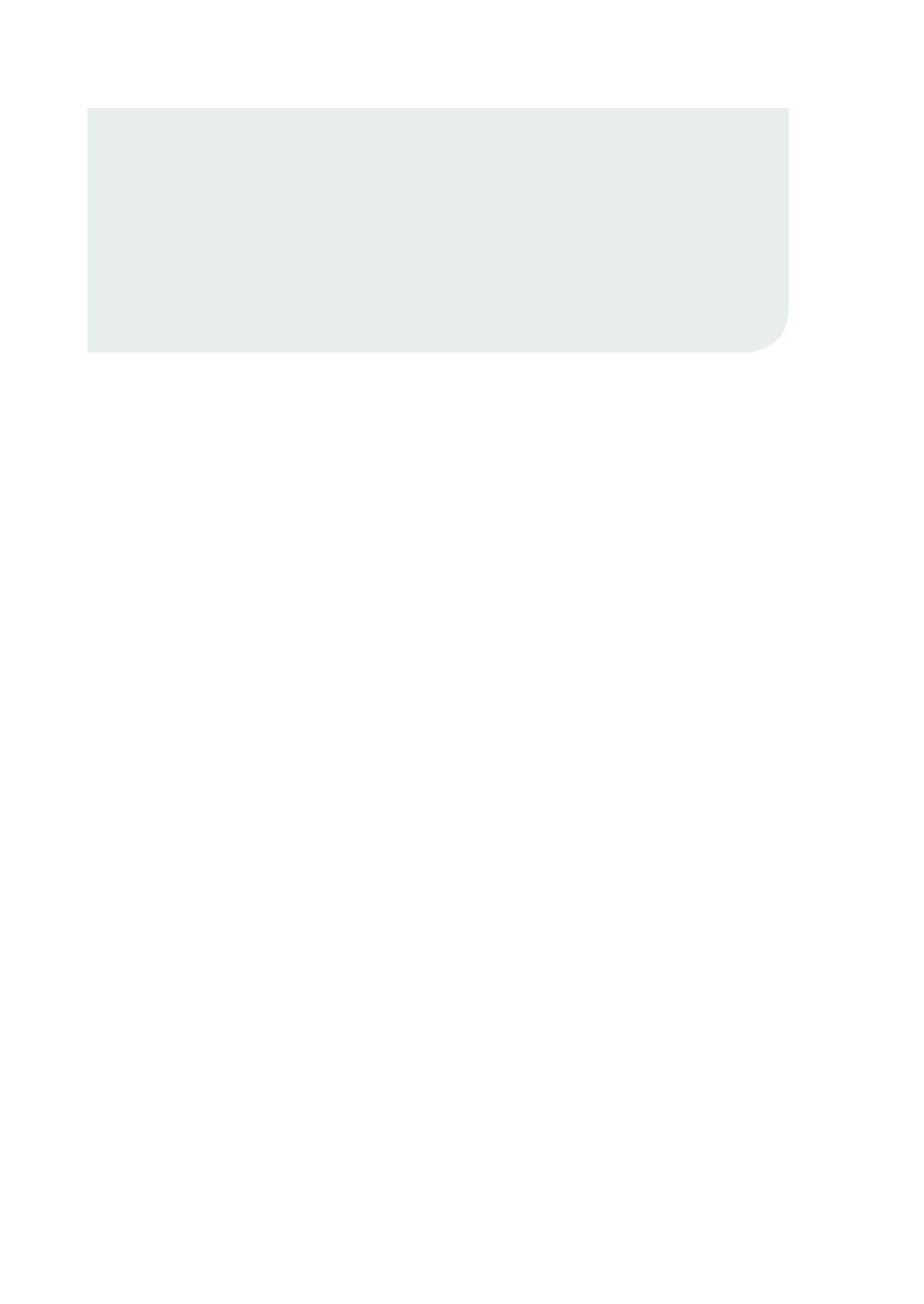
5.1 Was ist Gedächtnis?
145
5.1 Was ist Gedächtnis?
Bisher haben wir die verschiedenen
Niveaus und Formen
von Plastizität besprochen: die biolo-
gische Basis des Gedächtnisses und des Lernens (s. Kap. 3).
In diesem Kapitel liegt der Akzent
auf
Gedächtnis und Lernen
selbst, insbesondere im Rahmen der Konsequenzen für die Rehabi-
litation. Das Thema beschäftigt uns auch später im Buch beim Gedächtnistraining (s. Kap. 10).
Wie im Gehirn ist auch in diesem Buch Gedächtnis überall.
Gedächtnis ist keine eindeutige Funktion, keine umschriebene Einheit, sondern eine Entität
mit vielen Aspekten und Facetten. Plastizität ist zwar die biologische Basis, nicht aber die
Ursa-
che
von Gedächtnis, so wie ein Fernsehapparat auch nicht die Ursache des Fernsehprogramms
und ein Computer nicht die Ursache eines geschriebenen Textes sind. Fernseher und Computer
sind die physikalischen Medien, die die Weitergabe von Programmen und Nachrichten ermög-
lichen. Für das Ergebnis sind jedoch beide Elemente, Medium und Information, gleich wichtig.
Das eine ist ohne das andere bedeutungslos. Ausgezeichnete und gut illustrierte Darstellungen
von Plastizität und Gedächtnis finden sich bei
Squire
und
Kandel, Memory, from Mind to Mole-
cules
(2001), und
Baddeley, Your Memory; a user’s Guide
(2004), neben vielen anderen Büchern
und Übersichten auf unterschiedlichem Niveau (z. B. Cohen, 1989; Fuster, 1995; Markowitsch,
2001; Wolters und Murre, 2001).
Die neuronale Basis des Gedächtnisses liegt in den verschiedenen Formen der Plastizität, die
wir im dritten Kapitel besprochen haben (Langzeitpotenzierung [LTP], Langzeitdeprimierung
[LTD], Synapsen, Aussprossungen, genetische Informationen usw.). Verschiedene Hirngebiete
tragen zur Gedächtnisleistung bei, deren wichtigste mit ihren Aufgaben sind (Abb. 5.1):
●
Hippocampus:
Einprägung, Übergang vom Kurzzeit- zum Langzeitgedächtnis (Markowitsch
und Borsutsky, 2003),
●
Amygdala:
Konditionierung unter Einfluss von Emotionen (z. B. Angst),
●
Corpus striatum:
prozedurales Lernen, motorische Fertigkeiten (Schultz et al., 2003; Gold,
2003),
●
Cerebellum:
Erlernen neuer kognitiver und motorischer Fertigkeiten, klassische Konditonie-
rung,
●
Cortex:
modalitätsgebundenes Gedächtnis (sensorische Rindengebiete), Organisation, Ord-
nung, Strategie (frontale Rinde), Langzeitgedächtnis (weitverzweigte kortikale Netze) (Fries et
al., 2003; Fuster, 1995 und 1997); die Rolle des Lobus frontalis ist noch nicht abschließend
geklärt (siehe mehrere Artikel von Fletcher et al., 1997, 1998, 1999 und 2001).
Die Prinzipien des operanten Konditionierens schließen sich den Methoden der Physio-,
Logo- und Ergotherapie oft nahtlos an. Bei jeder Übung kann man ein sinnvolles Ziel, also
ein Element von „intrinsischem Reinforcement“ (positive Verstärkung), einbringen.
Lernen am Erfolg oder Aus-Fehlern-Lernen sind bei Patienten mit Hirnschädigung jedoch
nicht immer zielführend. Gelegentlich sind Techniken des fehlerfreien Lernens effektiver.
Auch verbale Instruktion und Feedback wirken nicht immer; manchmal erreicht man mehr
mit Demonstration und Imitation. Die meisten Lernprozesse enden mit dem Erwerb von
Bewegungsautomatismen oder Routinehandlungen. Am Ende wird das Erlernte selbstver-
ständlich, fließend und gezielt umgesetzt.