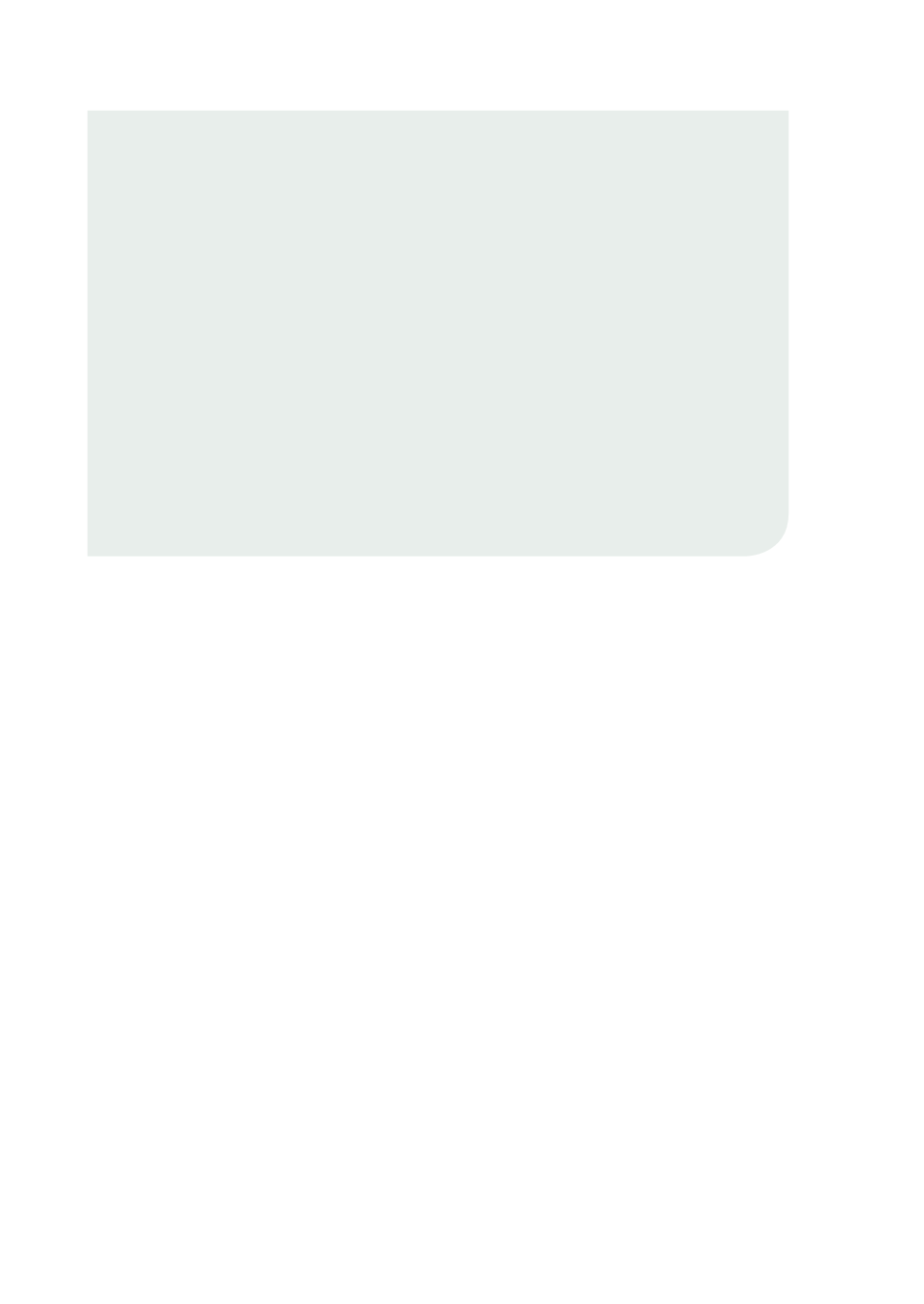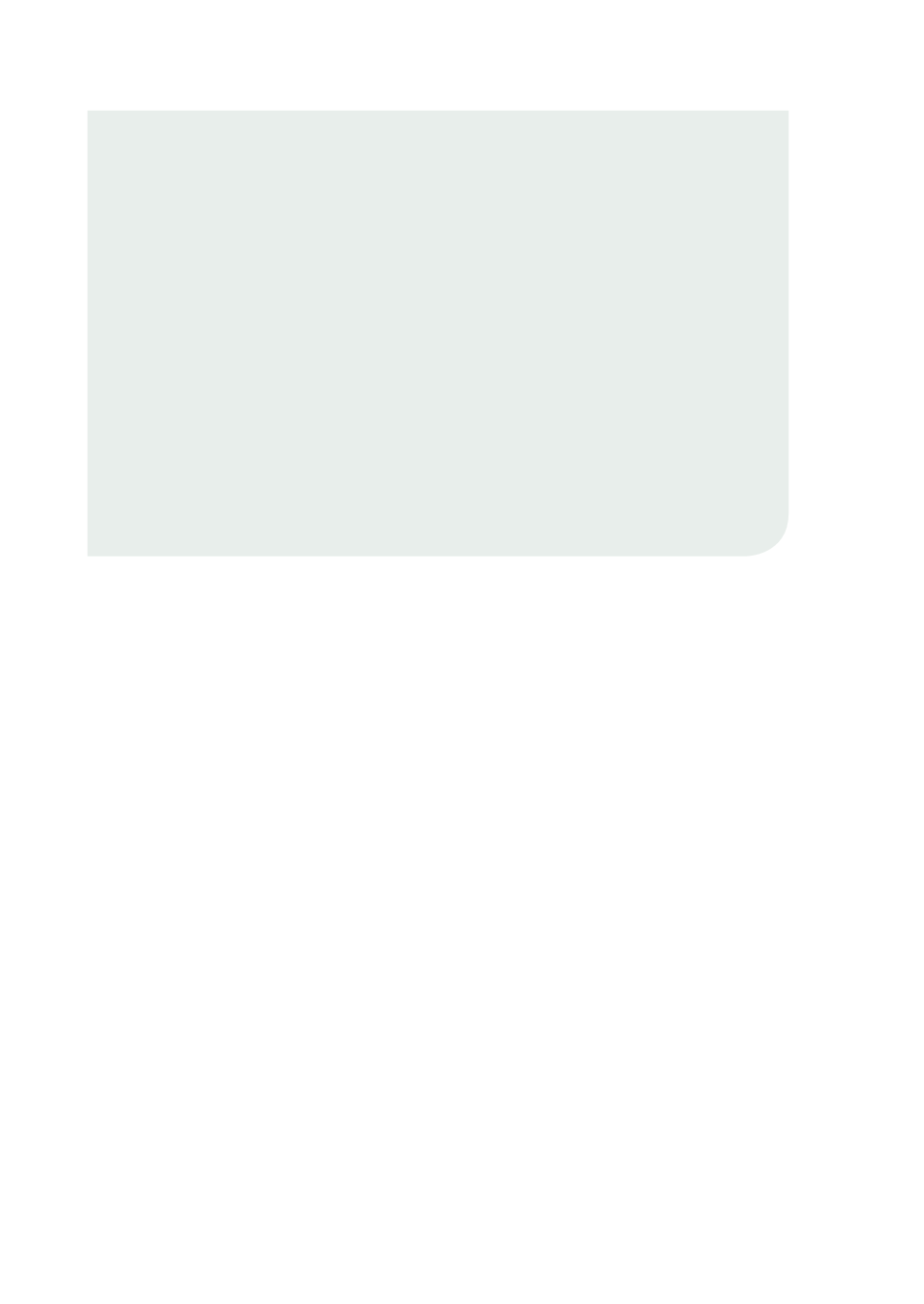
9.1 Grundprinzipien
231
In den Kap. 9, 10 und 11 behandeln wir die praktische Umsetzung von Programmen zur Neurore-
habilitation aus vier Blickwinkeln:
●
die therapeutische Situation
und ihre Optimierung (Kap. 9),
●
die Prinzipien und Methoden,
die zur Verfügung stehen: das therapeutische Repertoire
(Kap. 9),
●
störungszentrierte Therapien und Trainings:
welche Möglichkeiten bestehen bei bestimm-
ten Störungen (z. B. Kraft-, Gang-, Schreib-, Gedächtnis- und Aufmerksamkeitstraining
(Kap. 10).
●
patientzentrierte Therapien und Trainings:
wie können Rehabilitationsaktivitäten auf die
individuellen Bedürfnisse eines Patienten (z. B. Gärtner, Rechtsanwalt oder Bauunternehmer)
zugeschnitten werden (Kap. 11).
Die Standardtherapie ist eine Fiktion, da das therapeutischen Repertoire enorm ist. Die Frage ist
darum weniger, ob es eine Therapie gibt, sondern vielmehr, welche Methode wir bei welchem Pati-
enten wählen sollen.
9.1 Grundprinzipien
Für Patienten mit einer Hirnschädigung gibt es keine Allheilmethode. Dazu sind die Probleme
zu komplex und die betroffenen Personen zu unterschiedlich. Im besten Fall liefern vereinzel-
te wissenschaftliche Arbeiten Hinweise darauf, dass zur Behandlung einer bestimmten Störung
eine spezielle Methode einer anderen überlegen ist. Es gibt also keinen Grund, dogmatisch an
der einen oder anderen Methode festzuhalten, obwohl gerade das leider allzu häufig geschieht.
Die zur Verfügung stehenden Prinzipien und Methoden entstammen verschiedenen Fachdis-
ziplinen, insbesondere den Neurowissenschaften, der Psychologie, der Pädagogik und der reha-
Zur Behandlung von Patienten mit Hirnläsionen stehen uns zahlreiche Prinzipien und
Methoden zur Verfügung, die wir der Übersicht halber einteilen gemäß den vier Kompo-
nenten einer therapeutischen Situation: der
Patient
in seiner unmittelbaren Umgebung,
die
Übungen bzw. Therapie
im Rahmen des gesamten Behandlungsprogramms, der
The-
rapeut
und das Behandlungsteam und die Rolle des
Umgebungskontexts
.
Innerhalb jeder Kategorie können bestimmte Prinzipien und Methoden eingesetzt wer-
den. So appellieren beispielsweise mentale Bewegungsvorstellungsübungen an bestimm-
te mentale Aktivitäten des
Patienten
,
Übungen
können schrittweise zu Handlungsrei-
hen aufgebaut werden; der
Therapeut
begleitet und steuert das Üben, wobei er z. B. die
intakten neuralen Kanäle des Patienten nutzt; schließlich kann die Komplexität des
Umge-
bungskontexts
bewusst und schrittweise gestaltet werden. In zehn separaten Boxen wer-
den Hintergründe und praktische Anwendungen bestimmter Techniken ausgearbeitet:
Bewegungsvorstellung, Doppelaufgaben, Forced Use, Chaining, verbale Selbststeuerung,
Imitationslernen, fehlerfreies Lernen, Spiegeltherapie, Neglect-Training mittels motorischer
Aktivierung und Biofeedback. Wir besprechen sechs Faktoren, die uns bei der Auswahl hel-
fen können: individuelle Problemanalyse, Effektivitätsnachweis, Erfahrung, Wünsche, Mög-
lichkeiten und Begrenzungen.