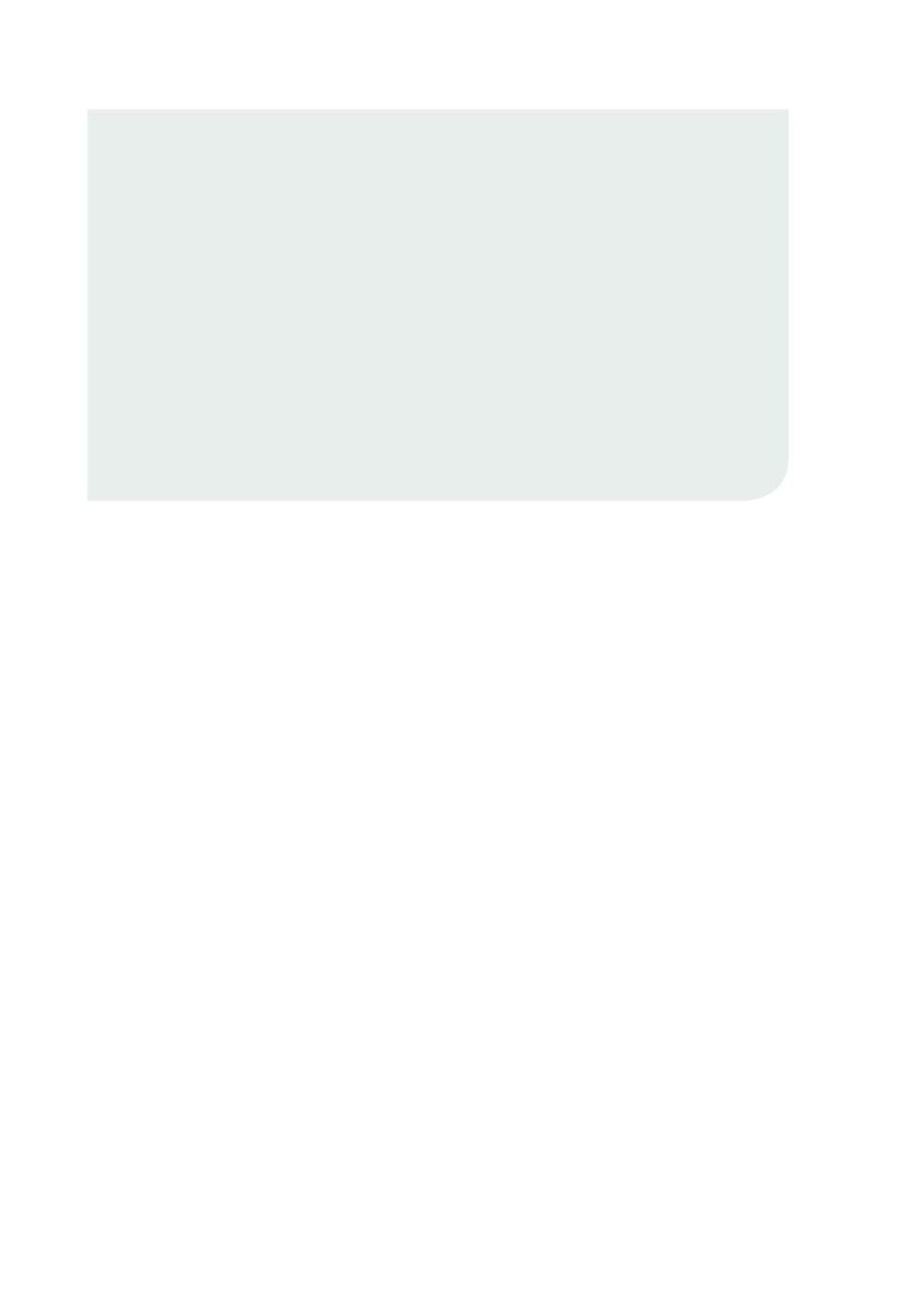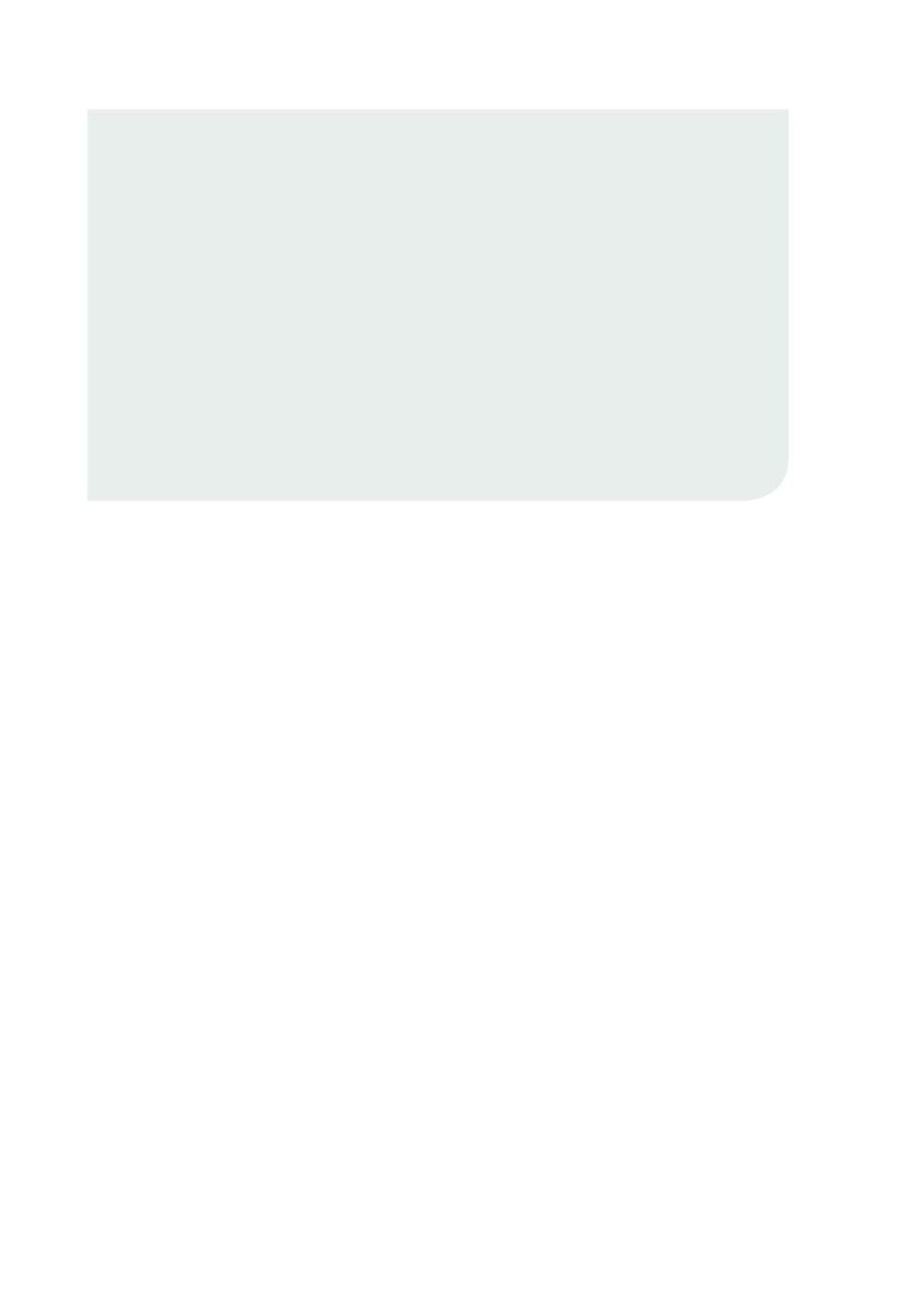
4.1 Einleitung
87
4.1 Einleitung
4.1.1 Vorgeschichte
Hirnschädigung hat es schon immer gegeben. In unseren Breiten waren Hirnschäden bis etwa
1950 vorwiegend die Folge von Schlaganfällen oder Kriegsverletzungen, danach zunehmend
von Unfällen im Straßenverkehr. Trotz aller Präventionsmaßnahmen wird das Problem größer,
da zum einen die Menschen immer älter werden (dadurch erhöhte Zahl an Schlaganfällen) und
zum anderen dank einer besseren Notfallversorgung immer öfter ein Schädel-Hirn-Trauma über-
lebt wird. In Entwicklungsländern nimmt die Inzidenz von Schädel-Hirn-Traumen aufgrund des
zunehmend höheren Lebensalters und erhöhter Unfallereignisse in der Schwerindustrie und im
Verkehr zu. Wir wissen aber auch, dass ungefähr 10 Prozent aller Patienten mit leichtem Schä-
del-Hirn-Trauma (sog. Gehirnerschütterung) langanhaltend oder dauerhaft Probleme empfinden
(z. B. Aufmerksamkeitsstörungen oder Persönlichkeitsveränderungen). Angesichts des beachtli-
chen Ausmaßes dieser Problematik sind das Desinteresse und die Ignoranz in der medizinischen
Welt gegenüber dieser Patientengruppe nur schwer nachvollziehbar.
Der Fortschritt unserer Disziplin hängt also weiterhin ab von der Leistung weniger Einzel-
kämpfer wie beispielsweise schon
John Hughlings Jackson,
der als Begründer der modernen Neu-
rologie bereits im Jahre 1880 das sogenannte „lesion momentum“, also die Plötzlichkeit, mit der
eine Hirnschädigung entsteht, zum wichtigsten prognostischen Faktor erklärt hat. Die Störun-
gen nach einer großen Schädigung, die in kurzer Zeit entsteht (Trauma, Schlaganfall), sind dem-
nach erheblich schlimmer als ein langsam fortschreitender Prozess oder mehrere kleine Defek-
te nacheinander (Tumor, TIA). Jackson beschrieb auch die funktionelle Ordnung über mehrere
Ebenen, wodurch bei jeder lokalen Läsion immer eine Anzahl Restmöglichkeiten übrig bleibt.
Um das Jahr 1915 herum formulierte
Shepherd Ivory Franz
einige „neuro-edukative“ Grund-
sätze für Patienten mit Hirnschädigung, und
Poppelreuter
entwarf Tests und Übungen für Men-
schen mit Schädigungen des Hinterhauptlappens.
Das ZNS selbst verfügt über Restitutionsmechanismen, die durch zielgerichtete Übungen
und Anpassungen der Umgebung stimuliert werden können. Nach einer peripheren Ner-
venschädigung liegt der Schwerpunkt auf der Wiederherstellung der ursprünglichen Ner-
venverbindungen – zunächst mittels einer vorläufigen, später mittels einer endgültigen
Wiederherstellung der Innervation. Zentrale Schädigungen erfordern ein anderes Vorge-
hen mit den Zielen einer neuen Aufgabenverteilung der beteiligten Hirnregionen (neura-
le Reorganisation), des Aktivierens von Hirnregionen (Überwindung einer Diaschisis), der
Zuhilfenahme anderer Funktionen (Kompensation) und einer Anpassung der Umgebung.
Die Umsetzung neuer Strategien erfolgt phasenweise und kann sich über Jahre hinziehen.
Sie betrifft nicht nur die Motorik (das Gehen), sondern auch die Sprache, das Gedächtnis,
die Aufmerksamkeit, die Emotionalität, das Interesse und die Sozialkompetenz des Patien-
ten. Der Erfolg der Rehabilitation lässt sich medizinisch (Medikamente, Transplantationen,
andere Erkrankungen), vor allem aber auch nichtmedizinisch steuern (Motivation, Krank-
heitseinsicht, Unterstützung, Wohnumgebung, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie).